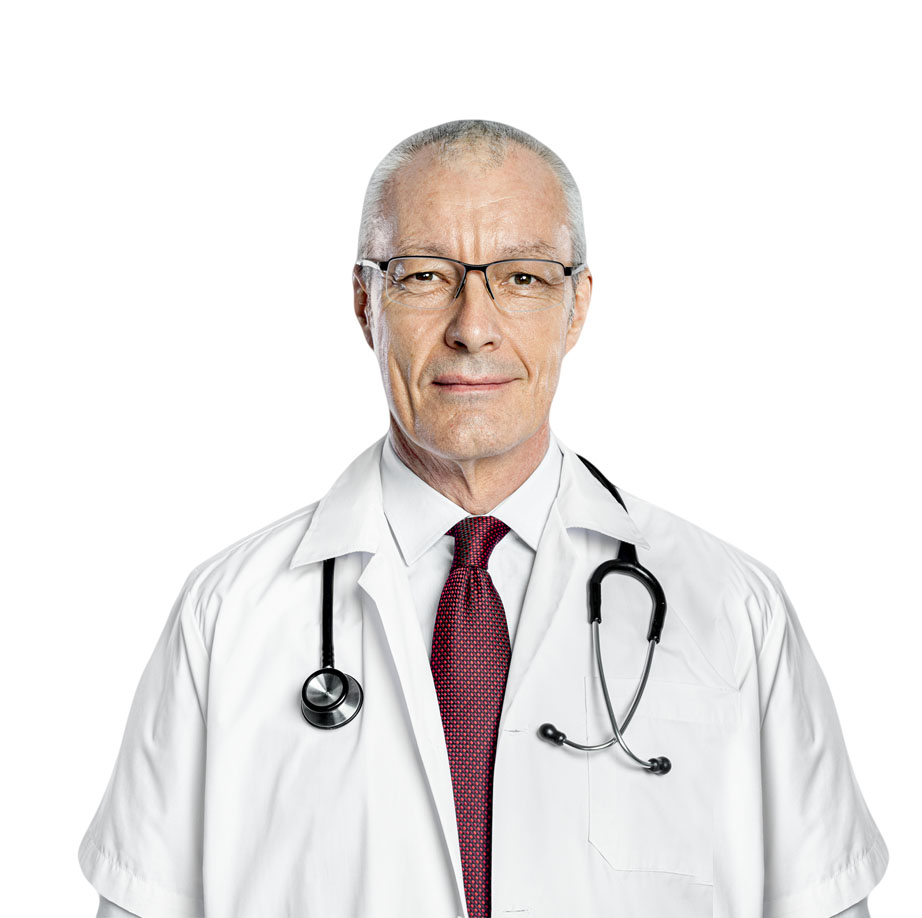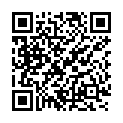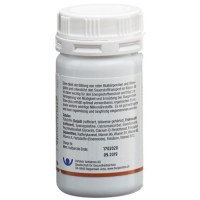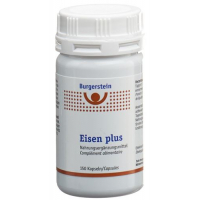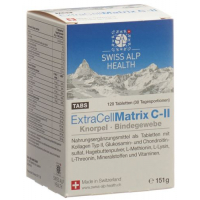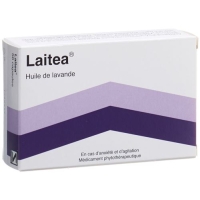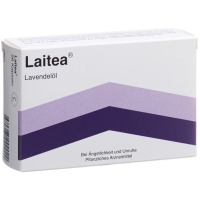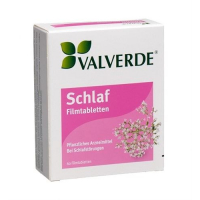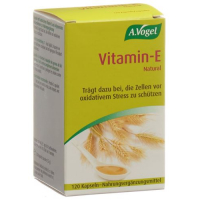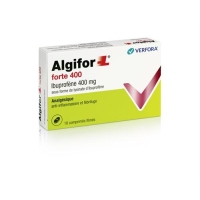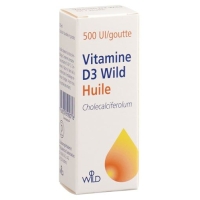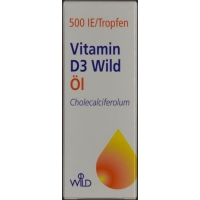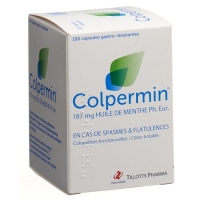QT-verlängernde Substanzen - Piperaquin
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängern Substanzen und Piperaquin kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Piperaquin ist die gleichzeitige Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen kontraindiziert.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
QT-verlängernde Substanzen - Lumefantrin
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen und Lumefantrin kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformationen von Lumefantrin ist die gleichzeitige Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen kontraindiziert.
Laut anderen Fachinformationen ist bei gleichzeitiger Behandlung mit Lumefantrin Vorsicht geboten. Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Schwerwiegende Folgen wahrscheinlich - kontraindiziert
Tizanidin - Enzyminhibitoren (CYP1A2)
Die CYP1A2-Inhibitoren können den Metabolismus von Tizanidin (CYP1A2-Substrat) hemmen, wodurch es, verstärkt durch einen hohen First-pass-Effekt von Tizanidin, zu stark erhöhten Plasmakonzentrationen von Tizanidin kommen kann.
In einer Studie war die AUC von Tizanidin durch orale Kontrazeptiva (Ethinylestradiol) fast auf das 4-Fache erhöht. Wiederholte Dosen von Vemurafenib, 960 mg zweimal täglich, erhöhten die AUC einer Einzeldosis Tizanidin von 2 mg im Schnitt auf das 4,7-Fache.
Verstärkte unerwünschte Wirkungen von Tizanidin möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit CYP1A2-Hemmern können vermehrt unerwünschte Wirkungen von Tizanidin auftreten: QT-Zeit-Verlängerungen, Hypotonie, Bradykardie, Mundtrockenheit, Müdigkeit, Schläfrigkeit und Schwindel.
Eine gleichzeitige Behandlung mit Tizanidin und CYP1A2-Inhibitoren ist nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Panobinostat - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Panobinostat und den anderen QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Panobinostat und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Panobinostat wird die gleichzeitige Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Entrectinib - QT-verlängernde Substanzen
Die QT-verlängernden Substanzen wurden in Zusammenhang mit einem Risiko für Torsade de pointes gebracht; Entrectinib hat in den klinischen Studien zu einer Verlängerung der QT-Zeit geführt. Die proarrhythmischen Wirkungen von Entrectinib und den QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Torsade de pointes
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Entrectinib und QT-verlängernden Substanzen werden verstärkt Arrhythmien, insbesondere Torsade de pointes, befürchtet.
Die gleichzeitige Behandlung mit Entrectinib und den genannten QT-verlängernden Substanzen ist nicht empfohlen.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
CYP2D6-Substrate mit enger therapeutischer Breite - Dacomitinib
Dacomitinib kann als starker CYP2D6-Inhibitor den Metabolismus von CYP2D6-Substraten hemmen.
Verstärkte Wirkungen von CYP2D6-Substraten mit enger therapeutischer Breite möglich
Bei gleichzeitiger Anwendung mit Dacomitinib muss mit verstärkten Wirkungen von CYP2D6-Substraten mit enger therapeutischer Breite gerechnet werden.
Laut Fachinformation von Dacomitinib ist die gleichzeitige Behandlung mit CYP2D6-Substraten mit enger therapeutischer Breite zu vermeiden.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
Sacituzumab govitecan - UGT1A1-Inhibitoren
Sacituzumab wird durch UGT1A1-vermittelte Glukuronidierung metabolisiert. UGT1A1-Inhibitoren können somit die Sacituzumab-Exposition erhöhen.
Verstärkte Wirkungen von Sacituzumab govitecan
Die UGT1A1-Inhibitoren können zu einer verstärkten Wirkung von Sacitzumab führen. Dabei können auch vermehrt unerwünschte Arzneimittelwirkungen auftreten, wie z.B. Infektionen, Blutbildstörungen, verminderter Appetit, Elektrolytstörungen. Das Risiko für Neutropenie, febrile Neutropenie und Anämie kann erhöht sein.
Laut Fachinformation von Sacituzumab ist die gleichzeitige Behandlung mit UGT1A1-Inhibitoren zu vermeiden.
Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert)
QT-verlängernde Substanzen - Protozoenmittel
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen und einigen Protozoenmitteln kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit mehreren QT-verlängernden Substanzen soll möglichst vermieden werden, andernfalls sollen Elektrolytstörungen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Substrate (CYP3A) - CYP3A-Induktoren
CYP3A4-Induktoren beschleunigen den oxidativen Metabolismus von CYP3A4-Substraten und senken deren Bioverfügbarkeit. Überdies induzieren einige dieser Stoffe Efflux-Transporter wie P-Glycoprotein, wodurch die enterale Absorption vermindert werden kann.
Rifampicin, 600 mg/Tag, senkte die AUC von Exemestan, 25 mg/Tag, um ca. 54 % und die des aktiven Metaboliten von Fesoterodin um etwa 70 %. Die Bioverfügbarkeit einer Einzeldosis von 375 mg Aprepitant am 9. Tag einer 14-tägigen Behandlung mit Rifampicin (600 mg/Tag) war um etwa 91 % vermindert. Rifampicin reduzierte die AUC von Rivaroxaban um etwa 50 %, die von Ticagrelor um ca. 86 %, die von Tofacitinib um 84 %, die von Idelalisib (150 mg) um 75 %. Mehrere 600-mg-Dosen Rifampicin verringerten die AUC einer 125-mg-Einzeldosis Palbociclib im Schnitt um 85 %.
Bei Gabe von Rifampicin täglich 600 mg 7 Tage vor und 7 Tage nach einer Einzeldosis von 180 mg Rolapitant war die AUC von Rolapitant um ca. 87 % und die seines aktiven Metaboliten um ca. 89 % vermindert.
Rifampicin, 600 mg täglich, verringerte bei gesunden Probanden die durchschnittliche AUC0-unendlich einer Einzeldosis von 1340 mg Tivozanib auf ca. 48 %; cmax und AUC0-24h waren nicht signifikant verändert.
Verminderte Wirksamkeit der betroffenen Stoffe möglich
Die gleichzeitige Behandlung mit CYP3A4-Induktoren kann die Wirksamkeit der betroffenen CYP3A4-Substrate (Apremilast, Aprepitant, Bortezomib, Cabazitaxel, Cinacalcet, Dabrafenib, Desfesoterodin, Dronedaron, Eplerenon, Etravirin, Exemestan, Fesoterodin, Fosaprepitant, Ibrutinib, Idelalisib, Ivabradin, Ivacaftor, Ixabepilon, Macitentan, Mifepriston, Olaparib, Palbociclib, Piperaquin, Rivaroxaban, Rolapitant, Rucaparib, Silodosin, Ticagrelor, Tivozanib, Tofacitinib, Tolvaptan, Trabectedin, Vismodegib) innerhalb weniger Tage beeinträchtigen.
Die gleichzeitige Behandlung mit den genannten CYP3A4-Substraten und CYP3A4-Induktoren soll vermieden werden; geeignete therapeutische Alternativen sind vorzuziehen. Wird dennoch gleichzeitig behandelt, sollen die Patienten sorgfältig auf eine verminderte Wirksamkeit hin beobachtet und die Dosierung des betroffenen CYP3A4-Substrats ggf. erhöht werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Domperidon - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängern Substanzen und Domperidon kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Domperidon und weiteren QT-verlängernden Substanzen ist Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Pitolisant - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Pitolisant und den anderen QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko von Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Pitolisant und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Pitolisant ist bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Ranolazin - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Ranolazin und den anderen QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Eine Populationsanalyse bei Patienten und gesunden Freiwilligen zeigte, dass das QTc um etwa 2,4 ms pro 1000 ng/ml Ranolazin stieg, was bei einer Dosis von 500–1000 mg Ranolazin zweimal täglich einem Anstieg von 2–7 ms entspricht.
Pharmakokinetische Interaktionen mit Plasmakonzentrationserhöhungen der Arzneistoffe können hinzukommen.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Ranolazin und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Ranolazin ist bei gleichzeitiger Behandlung mit weiteren QT-verlängernden Substanzen Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Levetiracetam - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Levetiracetam und weiteren QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Levetiracetam und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Levertiracetam ist bei gleichzeitiger Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Andere Fachinformationen können von dieser Empfehlung abweichen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
QT-verlängernde CYP3A-Substrate mit enger therapeutischer Breite - Ceritinib
Die proarrhythmischen Wirkungen von Ceritinib und den genannten CYP3A-Substraten könnten sich addieren oder potenzieren.
Zudem ist Ceritinib ein starker CYP3A-Hemmer und kann daher die Exposition gegenüber CYP3A-Substraten erhöhen.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Ceritinib und den genannten CYP3A-Substraten kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Ceritinib ist bei gleichzeitiger Behandlung mit den genannten CYP3A-Substraten Vorsicht geboten.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Alpelisib - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen der genannten QT-Zeit verlängernden Substanzen und Alpelisib können sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung zweier QT-verlängernder Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Laut Fachinformation von Alpelisib soll eine gleichzeitige Behandlung mit QT-verlängernden Substanzen mit Vorsicht erfolgen. Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Levofloxacin: Die Interaktion kann auch bei inhalativer Anwendung auftreten, da gelegentlich Plasmakonzentrationen wie nach peroraler Gabe vorkommen können.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Rucaparib - QT-verlängernde starke CYP3A-Inhibitoren
Rucaparib ist ein CYP3A-Substrat, starke CYP3A-Inhibitoren können daher seine Plasmakonzentrationen erhöhen.
Sowohl Rucaparib als auch die genannten CYP3A-Inhibitoren können das QT-Intervall verlängern; ihre proarrhythmischen Wirkungen könnten sich addieren oder potenzieren.
Verstärkte Wirkungen von Rucaparib möglich, erhöhtes Risiko für für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Starke CYP3A-Inhibitore können die Wirkungen von Rucaparib verstärken (z.B. Blutbildstörungen, gastrointestinale Störungen, Dyspnoe, Schwindel, Hautausschlag, erhöhte Transaminasen, erhöhtes Kreatinin, Hypercholesterinämie). Zudem kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Die gleichzeitige Behandlung mit Rucaparib und starken CYP3A-Inhibitoren soll mit Vorsicht erfolgen.
Zudem sollen Elektrolytstörungen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Eliglustat - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Eliglustat und QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Eliglustat und weiteren QT-verlängernden Substanzen ist Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
P-Glykoprotein-Substrate mit enger therapeutischer Breite - Tepotinib
Tepotinib ist ein Hemmer des P-Glykoproteins und kann daher die Wirkungen der P-Glykoprotein-Substrate verstärken.
Wiederholte Gabe von Tepotinib (450 mg einmal täglich) erhöhte die AUC von Dabigatranetexilat auf das 1.5-Fache und dessen Cmax auf das 1.4-Fache.
Verstärkte Wirkungen der P-Glykoprotein-Substrate möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Tepotinib sind verstärkte Wirkungen der P-Glykoprotein-Substrate mit enger therapeutischer Breite möglich.
Laut Fachinformation von Tepotinib wird die gleichzeitige Behandlung mit P-Glykoprotein-Substraten mit enger therapeutischer Breite im Allgemeinen nicht empfohlen; andernfalls soll die Fachinformation des jeweiligen P-Glykoprotein-Substrates konsultiert werden und deren Empfehlungen beachtet werden.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Pralsetinib - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen der betroffenen Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Pralsetinib und QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.
Torsade de pointes können mit Schwindel oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Pralsetinib und weiteren QT-verlängernden Substanzen ist Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Überwachung bzw. Anpassung nötig
Substrate (CYP3A) - PARP-Inhibitoren
Es ist nicht auszuschliessen, dass die PARP-Inhibitoren die Bioverfügbarkeit von CYP3A4-Substraten erhöhen. Die Wechselwirkungen wurden nicht untersucht.
Verstärkte Wirkungen der CYP3A4-Substrate möglich
Die gleichzeitige Behandlung mit PARP-Inhibitoren (Niraparib, Olaparib, Rucaparib) kann möglicherweise die substanzspezifischen Wirkungen von CYP3A4-Substraten verstärken (Alfentanil, Alfuzosin, Chinidin, Ciclosporin, Dihydroergotamin, Ergotamin, Fentanyl, Pimozid, Quetiapin, Sirolimus, Tacrolimus, Terfenadin, Triazolam).
Bei gleichzeitiger Behandlung mit PARP-Inhibitoren und CYP3A4-Substraten, besonders solchen mit kleinem therapeutischen Index, ist Vorsicht geboten.
Vorsichtshalber überwachen
Methylxanthin-Derivate - Rucaparib
Rucaparib hemmt CYP1A2 und CYP3A. Da der Metabolismus der Methylxanthine durch diese Isoenzyme katalysiert wird, ist davon auszugehen, dass Rucaparib deren Plasmakonzentrationen erhöhen kann. Rucaparib, 600 mg zweimal täglich, erhöhte die Bioverfügbarkeit von Coffein, 200 mg, ca. auf das 2,55-Fache.
Verstärkte Wirkungen der Methylxanthine möglich
Es ist nicht auszuschliessen, dass Rucaparib die Wirkungen von Theophyllin und Coffein verstärkt. Symptome einer Theophyllin- oder Coffein-Überdosierung sind Unruhe, Schlaflosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Tachykardie, Kopfschmerzen und erhöhte Krampfneigung.
Ist die gleichzeitige Behandlung zwingend erforderlich, sollen die Patienten sorgfältig auf die zu erwartenden unerwünschten Wirkungen und die Theophyllin-Plasmakonzentration überwacht werden. Dosisanpassungen können in Betracht gezogen werden.
Vorsichtshalber überwachen
Vitamin-K-Antagonisten - Rucaparib
Rucaparib ist ein schwacher Inhibitor von CYP2C9, welches den oxidativen Stoffwechsel von Warfarin katalysiert. Rucaparib, 600 mg zweimal täglich, erhöhte die Bioverfügbarkeit von Warfarin, 10 mg, ca. auf das 1,5-Fache.
Verstärkte blutgerinnungshemmende Wirkung möglich
Die gleichzeitige Behandlung mit Rucaparib kann die blutgerinnungshemmende Wirkung von Vitamin-K-Antagonisten verstärken und das Risiko von Blutungen erhöhen.
Bei gleichzeitiger Anwendung ist Vorsicht geboten und die Blutgerinnungsparameter sollen überwacht werden. Dosisanpassungen können in Betracht gezogen werden.
Vorsichtshalber überwachen
Phenytoin - Rucaparib
Möglicherweise hemmt Rucaparib den Metabolismus von Phenytoin über CYP2C9.
Verstärkte Wirkungen von Phenytoin möglich
Die gleichzeitige Behandlung mit Rucaparib kann die unerwünschten Wirkungen von Phenytoin (Schwindel, Tremor, Ataxie) in Einzelfällen vermehren bzw. verstärken.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Rucaparib soll vorsichtshalber auf verstärkte bzw. vermehrte unerwünschte Wirkungen von Phenytoin besonders geachtet und bei Bedarf die Phenytoin-Dosis gesenkt werden.
Vorsichtshalber überwachen
BCRP-Substrate - Acalabrutinib
Acalabrutinib ist ein BCRP-Inhibitor und kann die Exposition gegenüber BCRP-Substraten erhöhen. Die Interaktion wurde nicht untersucht.
Verstärkte Wirkung von BCRP-Substraten möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit BCRP-Substraten und Acalabrutinib wird eine verstärkte Wirkung der BCRP-Substrate erwartet.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit BCRP-Substraten und Acalabrutinib ist Vorsicht geboten; Patienten sollen auf UAW der genannten Substrate überwacht werden.Oral verabreichte BCRP-Substrate mit geringer therapeutischer Breite sollten mindestens 6 h vor oder nach Acalabrutinib eingenommen werden.
Vorsichtshalber überwachen
Rucaparib - Starke CYP3A-Inhibitoren
Rucaparib ist ein CYP3A-Substrat, starke CYP3A-Inhibitoren können daher seine Plasmakonzentrationen erhöhen.
Verstärkte Wirkungen von Rucaparib möglich
Starke CYP3A-Inhibitoren können möglicherweise die Wirkungen von Rucaparib verstärken (z.B. Blutbildstörungen, gastrointestinale Störungen, Dyspnoe, Schwindel, Hautausschlag, erhöhte Transaminasen, erhöhtes Kreatinin, Hypercholesterinämie).
Die gleichzeitige Behandlung mit Rucaparib und starken CYP3A-Inhibitoren soll mit Vorsicht erfolgen.
Vorsichtshalber überwachen
BCRP-Substrate - Tepotinib
Tepotinib ist ein BCRP-Inhibitor und kann die Exposition gegenüber BCRP-Substraten erhöhen.
Verstärkte Wirkung von BCRP-Substraten möglich
Bei gleichzeitiger Behandlung mit BCRP-Substraten und Tepotinib wird eine verstärkte Wirkung der BCRP-Substrate erwartet.
Bei gleichzeitiger Behandlung mit BCRP-Substraten und Tepotinib ist Vorsicht geboten; Patienten sollen auf UAW der genannten Substrate überwacht werden.
Vorsichtshalber überwachen
Lisdexamfetamin - QT-verlängernde Substanzen
Die proarrhythmischen Wirkungen von Lisdexamfetamin und weiteren QT-verlängernden Substanzen könnten sich addieren oder potenzieren. Diese Effekte sind weitgehend dosisabhängig.
Erhöhtes Risiko für Arrhythmien (Torsade de pointes)
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Lisdexamfetamin und weiteren QT-verlängernden Substanzen kann sich das Risiko einer proarrythmischen Wirkung inkl. Torsade de pointes erhöhen.Torsade de pointes können mit Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen einhergehen. Meist enden Torsade de pointes spontan; selten können sie aber auch in Kammerflimmern und Herzstillstand mit potenziell letalem Ausgang übergehen.
Bei der gleichzeitiger Behandlung mit Lisdexamfetamin und weiteren QT-verlängernden Substanzen ist Vorsicht geboten.
Elektrolytstörungen sollen vor der Anwendung korrigiert werden und das EKG überwacht werden. Bei einer Verlängerung der frequenzkorrigierten QTc-Zeit >50–60 ms bzw. >460–500 ms (unterschiedliche Grenzwerte in der Literatur angegeben) sollen die gefährdenden Arzneimittel abgesetzt werden. Ausserdem sollen die Patienten über das Risiko der Herzrhythmusstörungen informiert werden und bei Schwindel und Ohnmachtsanfällen sowie bei Durchfall oder Erbrechen (Elektrolytstörungen) umgehend einen Arzt aufsuchen.
Vorsichtshalber überwachen